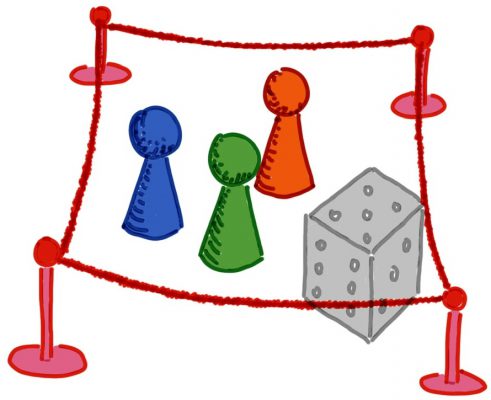
Ich glaube nicht an Safe Spaces. Das liegt daran, dass dem Konzept ein Dogmatismus innewohnt, der mich abschreckt.
Ich glaube, dass jeder das Recht auf Geborgenheit und Wohlwollen hat. Jeder sollte Lebensbereiche haben, in denen er oder sie oder es sich vollends geborgen fühlt und in dem ihm und ihr nur mit Wohlwollen begegnet wird. Das gilt ganz besonders für Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch für Erwachsene. Jeder braucht einen Raum, in dem er ganz er selbst sein kann. [Aus Lesbarkeitsgründen schreibe ich in der mir nahestehenden männlichen grammatischen Form weiter.]
Ein „safe space“ scheitert
Kann es denn überhaupt Sicherheit geben, wenn mehrere Menschen sich einen „safe space“ teilen? Besteht nicht die ständige Gefahr, dass eine Person etwas sagt oder tut, was eine andere als Verletzung aufgreift? „Mir hat die Kantinenfrau heute eine besonders große Portion gegeben“, berichtet vielleicht jemand. Jemand anders könnte sich nun durch diese unbedachte Äußerung angegriffen oder gekränkt fühlen:
- Da wird schon wieder in geschlechtlichen Klischees gedacht – darüber wollten wir doch endlich hinwegkommen und nicht immer alles auf Mann und Frau reduzieren.
- Da geht es ums Essen, dabei wollen wir doch nicht immer an körperliche Aspekte und Triebe erinnert werden.
- Da geht es womöglich um eine Speise, die unverträglich für einen anderen ist – dabei wollten wir doch rücksichtsvoll dieses Thema vermeiden.
- Da kann sich vielleicht nicht jeder einen Kantinenbesuch leisten, aus finanziellen oder zeitlichen Gründen.
- Da gibt es vielleicht politische oder systemische Vorbehalte, den Kantinenbetrieb durch Essenserwerb zu stützen.
Niemand hat eine Chance. Kein Thema hat eine Chance. Irgendjemand kann sich stets und ständig in seiner Wolke angegriffen fühlen. Niemand traut sich mehr etwas zu sagen aus Angst davor, jemanden irgendwie zu kränken. So wird der „safe space“ zum „silent suffering“. Das Safe-Space-Konzept erwartet förmlich, dass jeder stets und ständig – zumindest innerhalb des Raums – mit Samthandschuhen in Watte eingewickelt und mit all seinen Befindlichkeiten vollumfänglich ernst genommen und respektiert wird. Ganz egal, wie gaga und lebensfremd diese Befindlichkeiten sind.
Ganz besonders unerträglich wird es, wenn Person A etwas sagt und Person C dann vehement Rücksicht auf Person B einfordert. Diese Personen C, die stets und ständig überwachen, dass alle auch brav Rücksicht auf Person B nehmen, sind selbst den Betroffenen mitunter peinlich und lästig. Aber man wird sie nicht los. Und dass Person A ja auch ein Anrecht darauf hat, im wattierten „safe space“ eine Meinung zu äußern ist mit Blick auf Person B – jedenfalls aus Sicht von Person C – einfach nicht mehr möglich.
Ein Ort der Geborgenheit
Die Grundidee eines Ortes, wo sich jemand geborgen fühlen kann, ist sehr zu begrüßen. Doch Geborgenheit darf nicht mit wattierter Sicherheit verwechselt werden. Geborgenheit setzt voraus, dass man sich gegenseitig mit Rücksicht und Wohlwollen begegnet. Das schließt auch ein, dass mit Blick auf ein wichtiges Ziel, momentane Befindlichkeiten verletzt werden. Einen Ort solcher Geborgenheit zeichnet beispielsweise die Sitcom-Serie „Mom“ in ihren Bistro-Runden. Da unterstützen sich die Alkoholikerinnen gegenseitig mit Lebenshilfe, lästern übereinander und andere und rufen sich gegenseitig zur Ordnung. Für die Teilnehmerinnen ist es ein Ort der Geborgenheit und Unterstützung und sie können sich darauf verlassen, dass sie alle ein gemeinsames Ziel eint: trocken zu bleiben.
Ein „safe space“ kann einen solchen Ort nicht ersetzen, nur in einer fehlgeleiteten Utopie ist ein solches Konstrukt erstrebenswert. Ich spreche nicht über therapeutische „safe spaces“, sondern jene, die in den Lebensalltag integriert sind, beispielsweise in einer Uni (die englische Wikipedia führt Beispiele und Kritik an dem Konzept auf).
Wichtiger als die behauptete dogmatische Sicherheit („safety“) ist ein gegenseitiges Bewusstsein und das Schaffen eines Raumes, in dem es möglich ist, zivilisiert miteinander umzugehen. Im Zweifelsfall gilt nicht die Frage, was der andere gegen mich sagen wollte, sondern was seine Äußerung über ihn mitteilt. Das Lernen, Üben und Anwenden geeigneter Umgangsformen ist jedenfalls um Vieles wichtiger als das kategorische Ausblenden unangenehmer Lebensteile. Gemeinsam Wege zu ersinnen, damit umzugehen, wirkt letztlich befreiender als die Flucht in einen „safe space“.
Spielen als „safe space“
Ein besonderer Ort der Geborgenheit und Sicherheit bilden gemeinsame Spiele, insbesondere Gesellschaftsspiele. Gemeinsam taucht man in eine andere Welt ein, unterwirft sich Regeln, deren Verstöße geahndet werden und verbringt eine angenehme, heitere Zeit miteinander. Das gemeinsame Spielen schafft nicht nur soziales Kapital, sondern schult und trainiert auch die soziale Kompetenz. Der Umgang mit kompetetiven Situationen, mit Regelverstößen und Zufallsverteilung sowie das Reagieren aufeinander ist eine befreiende Welt außerhalb des sonstigen Alltags.
Man spielt ja nicht mit jedem. Man spielt nicht jedes Spiel. Man spielt nicht immer. Durch die Auswahl der Mitspieler oder Spielrunde, des Spiels und Auswahl der Spielsituation und -zeit bestimmt man wesentlich die Atmosphäre mit. Dadurch ergibt sich ein Ort der Geborgenheit, in dem klare, eindeutige Regeln gelten. Der große Vorteil von Spielen ist deren Eindeutigkeit von Regeln – während im Alltag die Regeln oft vage, selten explizit sind und oft auf Erwartungen und Annahmen basieren.
Fühlt man sich in einer Spielrunde oder -sitation unwohl, kann man diese stets verlassen. Man hat sich ja gemeinsam in diesen sozialen Raum hineinbegeben. Im Gegensatz zum realen Leben, wo man sich in Job, Familie oder anderswo gefangen fühlen kann, ist es stets möglich, eine Spielwelt einfach so zu verlassen oder den anderen zuliebe, einfach stoisch zu Ende zu spielen.
Der Reiz von Spielen liegt in ihren Grenzen
Insofern ist auch die Begeisterung für Computer- und Konsolenspiele verständlich. Denn diese liefern ebenso eine sichere Welt mit klaren Regeln. Während es im Alltag oft anstrengend ist, alle Regeln erstens zu kennen und zweitens einzuhalten und dennoch erfolgreich zu sein, ist dies genau das Ziel von Spielen: Innerhalb der Regeln erfolgreich zu sein.
Außerdem ist ein Spiel immer räumlich oder zeitlich begrenzt und bietet so zusätzliche Sicherheit. Gerade die erkennbaren oder benannten oder spielbildenden Grenzen verleihen die Sicherheit. Damit unterstützen sie das Kontrollbedürfnis, denn die Spielwelt ist durch ihre räumlichen und zeitlichen Grenzen endlich und damit überschau- und beherrschbar.
In Spielen kann man aus seiner Haut heraus und einmal ganz andere Strategien oder Verhaltensweisen probieren. Oder man bleibt ganz bei sich und folgt auch in der Spielausübung seinen Lebensprinzipien. In beiden Fällen findet eine ungefährliche Auslotung von Grenzen statt. Es besteht keine Gefahr für Leib und Leben, denn ein Spiel kann man einfach wieder neu starten.
Spiele bieten somit eine geordnete, begrenzte Weltflucht. Das ist für alle Beteiligten angenehmer als jeder kategorische „safe space“.
Übrigens ermöglicht mein Spiel „Karriereleiter“ (Amazon), verschiedene Karriereoptionen auszuprobieren. Das ist völlig ungefährlich und weitet den Blick auf die Möglichkeiten im echten Leben. In Handwerk, Konzern oder öffentlichem Dienst steigt man bis zum Boss, CEO oder Minister auf. Alles, was es dazu benötigt, sind ein paar Karten, ein klein wenig Glück und vor allem Geschick.

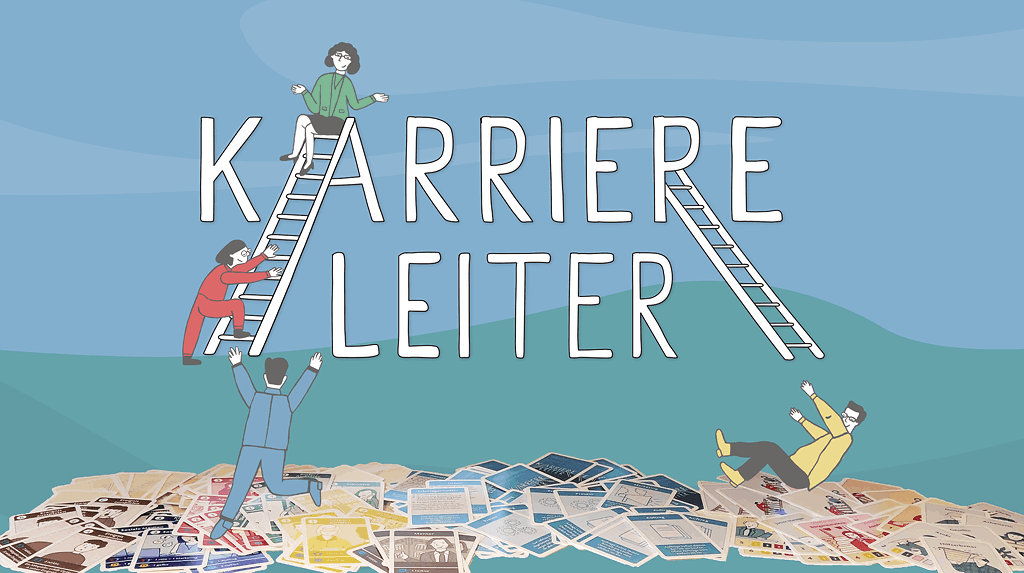
 ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||
ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||