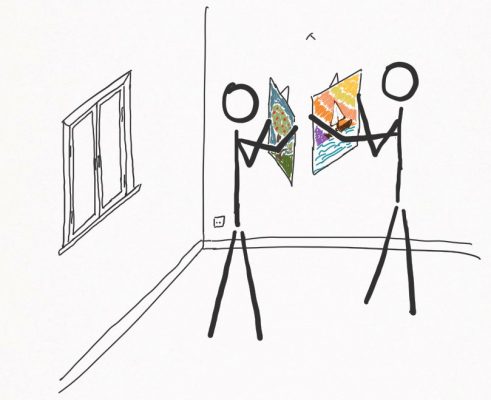
Dies ist ein dreiteiliger Essay über die Wirkung von Räumen auf Menschen.
- Teil 1: Fremde Räume – Kirche, Kaserne, Großraumbüro
- Teil 2: Geteilte Räume – Wohnung, Mehrpersonenbüro, öffentlicher Raum
- Teil 3: Eigene Räume – Elsas Eispalast, Raumschiffe, Arbeitszimmer, Kinderzimmer
Der Hauptunterschied zwischen fremden und geteilten Räumen liegt in unserer Gestaltungsmacht. In einem fremden Raum gestaltete eine höhere Macht die Räume und bestimmte die Regeln für den Aufenthalt darin. In geteilten Räumen wird uns der Raum zur Nutzung überlassen, sein räumlicher Ist-Zustand ist also gesetzt. Aber die konkrete Ausgestaltung sowie die Regeln des Miteinanders darin obliegt uns, den tatsächlichen Nutzern.
In einer Ferienwohnung (fremder Raum) beispielsweise käme niemand auf die Idee, die Möbel umzustellen, das Schlafzimmer zum Wohnzimmer umzuwidmen und die Bilder an den Wänden durch Wand-Tattoos zu ersetzen. In einer WG (geteilter Raum), die eine gleichartig geschnittene Wohnung bezieht, ist dies jedoch selbstverständlich. Jeder gestaltet sich seinen Wohnbereich so, wie er oder sie es als angenehm empfindet. Für die gemeinsamen Räume (Küche, Bad, Flur, ggf. Wohnzimmer) werden Regeln ausgehandelt, die als Putzplan oder lose Übereinkunft gelten. Sie können jederzeit an neue Erfordernisse angepasst werden.
Geteilter Raum ist definiert durch zwei Kennzeichen:
- Der Raum als solcher ist in seinem Ausmaß und Grundzuschnitt vorgegeben. Die Nutzer können diesen Raum – ohne Furcht vor Ahndung – in gegebenem Rahmen individuell umgestalten.
- Die Nutzung dieses Raumes erfolgt durch mehrere Personen, denen allenfalls Grundregeln vorgegeben werden (z.B. eine Hausordnung, die die Haltung von Haustieren oder Ruhezeiten regelt).
Damit ergibt sich der wichtigste Faktor für das Leben oder das Nutzen geteilter Räume in der sozialen Interaktion. Die Menschen in geteilten Räumen stellen die Regeln ihres Miteinanders selbst auf, sie handeln sie miteinander aus, entweder direkt in Gesprächen oder indirekt durch Lob und Tadel von erwünschtem und unerwünschtem Verhalten.
Wohnung
Eine Familie, die eine neue Wohnung bezieht, erlebt diese als geteilten Raum. Sind die Kinder noch zu klein, werden sie als Verhandlungspartner nicht ernst genommen, aber theoretisch sind alle gleichberechtigt und handeln miteinander aus, welcher Raum wie genutzt werden soll. Der Grundriss motiviert meist bereits manche Nutzungen, beispielsweise wird das größte Zimmer oft zum Wohnzimmer. Ob aber eines der kleineren zum Arbeits-, Schlaf-, Jugend- oder Kinderzimmer wird, ist zu vereinbaren. Ist diese Aufteilung geklärt, beginnt die Gestaltung mit Möbeln, deren Platzierung im Raum sowie die Dekoration der Wände. Auch das Arrangement der Beleuchtung ist ein häufiger Anlass für Verhandlungen.
Solange die bauliche Substanz nicht verändert wird, kann sich die Familie in der Wohnung voll in ihrem Gestaltungswillen entfalten. Spannend wird im nächsten Schritt das Aushandeln der Regeln des Miteinanders. Gibt es kleine Kinder oder einen Schichtarbeiter in der Familie, werden Ruhezeiten geklärt. Auch Rituale zur (gemeinsamen) Mahlzeiteinnahme, zum Fernsehen, zur Anmeldung von Abwesenheiten oder Gästen sowie Putzvereinbarungen oder -zuständigkeiten müssen ausgehandelt werden. Oft wird dabei auf Erfahrungen aus dem bisherigen Leben (in der vorigen Wohnung, in früheren Familien, z.B. bei den jetzigen Großeltern) zurückgegriffen.
Um manche Diskussionsfelder gar nicht erst zu eröffnen, erhalten Kinder ihre eigenen Fernseher oder andere Freiheiten, die ihre Eltern als Zeichen ihrer modernen Aufgeklärtheit verklären (so gut hätten sie es in ihrer Kindheit schließlich nicht gehabt). Zur Vermeidung potenzieller Konflikte wird auch die Menge der Nutzer möglichst reduziert, das Zusammenleben von mehr als zwei Generationen ist eine Rarität geworden, und Kinder ziehen so schnell aus, wie sie es sich leisten können.
Die Herausforderung besteht im Alltag weniger in den Räumen, als vielmehr in der sozialen Kompetenz ihrer Ko-Nutzer und der Bereitschaft, die Regeln des Miteinanders konstruktiv auszuhandeln. Folgendes Beispiel verdeutlicht das Dilemma: Hanka und Paul möchten ihren Nachwuchs (Max) für das Klavierspielen begeistern. Das alte Klavier von Hankas Oma wird aufgearbeitet, gestimmt, und Max erhält Klavierunterricht. Jeden Tag soll er mindestens eine halbe Stunde üben, besser bis zu zwei Stunden. Max ist außerdem in Sportvereinen aktiv und meist wie seine Eltern erst nach 16 Uhr zuhause. Hanka und Paul haben unterschätzt, welch unschöne Klaviertonfolgen übende Kinderfinger erzeugen können. Fernsehen, etwas lesen, eine gemütliche Unterhaltung, entspannen beim Kochen – Pustekuchen, wenn Max übt. Natürlich unterstützen Hanka und Paul ihren Max, aber muss er ausgerechnet jetzt üben? Die Tagesschau beginnt. Die Steuererklärung muss noch erstellt werden. Für die Arbeit ist noch etwas vorzubereiten. Max übt Klavier.
Die vier Räume der Wohnung von Hanka, Paul und Max werden zum Gefechtsfeld der Interessen. Für Hanka und Paul wird es zu einem Entweder–Oder: klavierspielender Max oder glückliches Leben im trauten Heim. Die Dynamik ihres Zusammenlebens verliert an Offenheit und gerät in starre „jetzt nicht“-Positionen. Das Problem verstärkt sich, da Max tatsächlich Freude am Klavierspielen hat und gern übt. Schließlich einigen sich Hanka, Paul und Max auf einen Übungsplan: Jeweils am Sonntag planen sie gemeinsam die kommende Woche und vereinbaren Zeiten, in denen Max übt, ohne dass seine Eltern sich gestört fühlen dürfen. Überraschenderweise entsteht als Nebeneffekt für alle eine jeweils gut geplante Woche. Interdependenzen werden aufgelöst, bevor sie aufeinanderprallen, und so ergeben sich auch für Hanka und Paul Freizeitkontingente beispielsweise für Kinobesuche, Treffen mit Freunden oder Spaziergänge.
Der geteilte Raum hat durch seine Begrenzungen, in dem mehrere Personen miteinander auskommen, eine Vereinbarung innerhalb verursacht. Diese wurde nicht durch fremde oder externe Mächte den Menschen verordnet. So ein geteilter Raum hat eine ähnliche Funktion wie ein 32er Deck Kartenspiel. Erst die Personen entscheiden, was sie damit spielen: 17 und 4, Skat, Maumau, Solitäre, Quartett, Poker oder etwas ganz anderes. Es liegt also in der Hand der Spieler, die Art und Komplexität des Spiels und damit den Spielspaß (gemeinsam) zu bestimmen.
Mehrpersonenbüro
Im Gegensatz zu den vielfältigen Nutzungen einer Wohnung (soziales Beisammensein, Nahrungsspeicher, -zubereitung, -aufnahme, Schlafen, Hobbys, Fernsehen, Lesen, Arbeiten, Unterlagen erstellen und archivieren) hat ein Büro einen sehr beschränkten Nutzungszweck. Eine Wohnung ist meist in einer Weise eingerichtet, dass man sich in ihr auch wohlfühlt, wenn man gerade gar nichts tut. Dazu gibt es Bilder an den Wänden, die Aussicht aus dem Fenster oder vom Balkon, Dekoration auf Regalen und Schränken, Teppich- und Gardinenmuster. Der Aufenthalt in einem Büro dagegen hat einen ganz pragmatischen Hintergrund: Mit möglichst wenig Aufwand sollen die gestellten Aufgaben erledigt werden. Daher ist Pragmatismus bei der Büro-Einrichtung das Primat. Dass sich die Personen bei der Arbeit auch wohlfühlen, ist sekundär. Wie das Großraumbüro zeigt, muss sich der Grad des Pragmatismus an den Aufgaben orientieren. Ist aus baulichen Gründen oder aufgrund der Aufgaben kein Großraumbüro möglich, sondern kleinere Büros, die sich zwei bis acht Personen teilen, so folgt das Zusammenleben und vor allem -arbeiten darin anderen Regeln als in einem Großraumbüro.
Meist erhalten die Büronutzer Gestaltungsfreiheit über „ihren“ Büroraum: Sie können die Anordnung der Schreibtische, die Platzierung von Regalen, die Ausstattung (z.B. Garderobenständer, Unterschränke, Grünpflanzen) mitbestimmen. An den Wänden landen meist ein Kalender und Bilder, die zumindest nicht auf Ablehnung stoßen. Oft bestimmt weniger die allgemeine Zustimmung solche Details, sondern es genügt fehlender Widerspruch.
Entscheidender sind die Verhaltensregeln, die sich zwischen den Nutzern herausbilden. Diese kreisen meist um den Bereich der akustischen Störung: Musikhören, Telefonieren, Unterhaltungen. Aber auch die Art der Kooperation (wie bzw. wann darf ein Mitarbeiter angesprochen und gestört werden; ist es gleichwertige Zusammenarbeit, oder arbeitet einer nur dem anderen zu) müssen ausgehandelt werden.
Dazu kommen die Fenster- und Tür-Politik. Fenster auf oder geschlossen? Bleibt die Tür geöffnet oder zu? Je nach Büro-Umfeld und Vorlieben werden andere Regelungen vereinbart. Kritisch kann es werden, wenn ein Dauer-Fenster-Auf-Verfechter und ein „Das Fenster bleibt geschlossen“-Dogmat sich einen Raum teilen. Die Anordnung der Schreibtische wird dieses Dilemma widerspiegeln, und vermutlich werden sich beide auf Zeiten verständigen, sodass beispielsweise von 9 bis 9.30 Uhr das Fenster geöffnet bleibt – dann ist der „Zu“-Kollege eh meist in einem Meeting.
Olfaktorische Belästigungen durch Duftstäbchen, Raumdüfte oder Essen am Schreibtisch werden selten direkt ausgetragen. Schließlich weiß doch jeder, was sich gehört … Aber da jeder eine andere soziale Historie hat, verfügt jeder über andere Erwartungs- und Toleranzbereiche. Die Herausforderung des geteilten Raumes besteht darin, dass das Raum-Erleben mit vier Sinnesebenen erlebt wird: optisch, akustisch, olfaktorisch und haptisch. Nur der Geschmackssinn bleibt (hoffentlich) außen vor. Für die pragmatische Bürosituation gilt die Profanisierung von Darwins Beobachtung: „Der Mensch mag nicht den Raum, der ihm am attraktivsten erscheint, sondern jenen, der ihn am wenigsten abstoßend erscheint.“ (im Original: Das Weibchen sucht sich nicht das Männchen, das ihm am besten gefällt, sondern das, das es am wenigsten abstoßend findet.)
Im Gegensatz zum (Über-)Leben im Büro ist die Kirche insofern einfach zu „erlernen“, weil die Regeln bestehen, zur Kenntnis genommen und befolgt und nicht hinterfragt werden. Das Miteinander-Leben im Büro ist dagegen deutlich schwieriger. Denn abgesehen von einigen Grundregeln kommt es vor allem auf die Details und scheinbaren Kleinigkeiten an. Auch ist der Tag nicht so durchritualisiert, sondern enthält viele Einzelfälle. Diese Rituale sind jedoch kaum strikt kodifiziert, sie wandeln sich und sind stark von den beteiligten Personen geprägt. In einem Mehrpersonenbüro werden die Nutzer gemeinsame Konventionen für das Miteinander aushandeln, ob nun direkt im Dialog oder durch Loben erwünschten Verhaltens und Tadeln von unerwünschtem Verhalten. Abhängig von der konkreten Bürobesetzung werden dabei andere Verhaltensregeln ausgeprägt.
Im Gegensatz zum Kirchenschiff kann das Büro tatsächlich partiell zum „eigenen Raum“ werden. Kaffeeflecken auf dem Schreibtisch, Familienbilder neben dem Monitor, persönliche Ordnung der Nachschlagewerke im Regal, Grünpflanzen auf dem Fensterbrett, vielleicht ist sogar der Lieblingssender im Radio eingestellt. Der geteilte Raum besteht somit letztlich aus vielen Teil-Räumen, die als eigener Raum wahrgenommen und gegen unerwünschte Einflüsse verteidigt werden.
Grenzfälle: öffentlicher Raum
Per Definition kann ein öffentlicher Raum kein fremder Raum sein, sondern ist ein geteilter Raum. Dazu gehören beispielsweise Straße, Plätze, Parks, Bahnhöfe, sogar Museen, Schwimmhallen oder Festivals können als Vertreter angesehen werden. Allen ist gemein, dass sie zwar keiner „fremden Macht“ gehören, aber dennoch unterliegen sie jeweils kodifizierten Regelungen für den Aufenthalt: Straßenverkehrsordnung, Parkordnung, Hausordnung.
Der Unterschied zum fremden Raum besteht darin, dass – zumindest theoretisch – nicht eine Instanz die Regeln aufstellt, und diese sind vorbehaltlos zu befolgen, sondern diese Regeln entsprechen einem allgemeinen Konsens über erwünschtes und unerwünschtes Verhalten. Sie regeln das Miteinander so, dass sich die anderen Personen in diesem Raum auf ein bestimmtes Verhalten der anderen verlassen können. In gewisser Weise sind sie einerseits kodifizierte Etikette und sollen andererseits den Erhalt des gemeinsamen geteilten öffentlichen Raumes gewährleisten.
An den Regelungen zum Nichtraucherschutz lässt sich das nachvollziehen. Galt bis dahin die individuelle Freiheit des Überall-Rauchen-Dürfens, so traten zunehmend die gesellschaftlichen Kräfte in den Vordergrund, die sich den Nebenwirkungen nicht aussetzen wollten. Auch Raucher werden kaum bestreiten, dass Passiv-Rauchen zumindest unangenehm ist. In seinem eigenen Raum kann jeder selbst Rauch-Regeln aufstellen bzw. in einem fremden Raum hat die Regel-aufstellende Instanz das Recht, über Rauchen oder Nichtrauchen zu entscheiden. In einem geteilten Raum dagegen entscheidet der gesellschaftliche Konsens. Der besteht darin, dass Waldbrände unerwünscht sind – also verbietet die Gesellschaft das Werfen von Zigaretten aus dem Auto. Gleichermaßen wurde der Schutz der nichtrauchenden Mehrheit über das Interesse der rauchenden Individuen gestellt und das Rauchen in verschiedenen geteilten Räumen untersagt: auf Bahnhöfen und Flughäfen, in Restaurants (für die aus juristischer Perspektive die Regeln zum geteilten Raum zumindest partiell gelten).
Im öffentlichen Raum werden die Regeln des Miteinanders nicht direkt ausgehandelt, sondern über eine legitimierte Instanz eingerichtet. Dabei gilt die Verhältnismäßigkeit bzw. das Primat des Gemeinwohls.
Geteilte Räume formen uns
In der idealen Welt gibt es nur verständige Menschen, die miteinander reden, Verhaltensregeln vereinbaren, Verstöße ahnden und Kompromisse aushandeln können. Das setzt eine gewisse Reife, Lebenserfahrung und Kommunikationsfähigkeit voraus.
Bei Kindern beispielsweise funktioniert dies nur innerhalb einer Altersklasse gut, daher übernehmen oft die Eltern die Kommunikation und Verhandlungen für ihre Kinder. Das wiederum schult die soziale Kompetenz der Eltern – sofern sie nicht autokratisch vorgeben, wie sich ein Kind zu verhalten hat, sondern tatsächlich als Anwalt dessen Interessen vertreten. Das führt jedoch dann zu Konflikten, wenn die Kinderinteressen mit den Elterninteressen kollidieren und die Eltern ihre Autorität ausspielen – dann können für Kinder aus geteilten Räumen die fremden Räume der Eltern werden. Auf der anderen Seite bedeuten geteilte Räume auch für Kinder, Kompromisse einzugehen und sich an Regeln zu halten, die dem Miteinander förderlich sind.
So werden beispielsweise im Kindergarten und in der Schule die Wände von den Kindern häufig mitgestaltet und sind von deren Werken verziert. Die Kinder werden dazu angehalten, ein Grundmaß an gemeinsamer Ordnung zu halten und die Regeln des Ortes zu respektieren. Aber daneben haben sie viel Freiraum, sich miteinander zu verständigen und spielend soziale Kompetenz zu erlernen: Wer spielt mit wem und womit im Buddelkasten, Wer darf heute den Tischspruch zum Mittag sagen, Welche Bilder wollen wir an die Wand hängen, Mit welchen Stiften wollen wir malen, Wer sitzt neben wem, etc.
Während in einer WG die Regeln im Wesentlichen von der Hausordnung und den Bewohnern aufgestellt werden, haben beispielsweise in einem Internat die Bewohner deutlich weniger Regelungsfreiheit. Je nach Ziel ist die Unterbringung kasernen- oder WG-ähnlicher angelegt und entsprechend eng oder weit der Gestaltungsspielraum für die Räume und das Leben darin.
Geteilte Räume werden für einen Zeitraum für einen bestimmten Zweck von mehreren Personen gleichzeitig genutzt. Dieser Zeitraum kann wenige Minuten bis viele Jahre betragen. Auf einem Bahnhof erwartet man üblicherweise nur wenige Minuten Aufenthalt, in einer Wohnung mehrere Jahrzehnte, in einer WG einige Monate oder wenige Jahre. Vor diesem Erwartungshorizont werden die Regeln ausgehandelt. Auf einem Bahnhof werden sich die Personen kaum gegenseitig „erziehen“ und nur Extreme von Verhalten kritisieren.
Abgesehen von Grundregeln sind die Formen des Zusammenlebens in geteilten Räumen jeweils pro Gruppe ausgehandelt und selten kodifiziert. Da sie oft auf Erfahrungen und bisheriger Biografie beruhen, sind Erst-WG-Bewohner im Nachteil, wenn sie mit WG-Erfahrenen zusammenziehen. Für diese sind bestimmte Verhaltensregeln selbstverständlich und müssen nicht geklärt werden. Zur sozialen Kompetenz gehört eben auch, das Wissen, „was man tut und was nicht“ zu kennen oder zumindest schnell aus dem erlebten Verhalten der anderen diese Regeln ableiten, akzeptieren und anwenden zu können. Zu erkennen, wann Verhandlungen nötig sind und wie gemeinsam ein Konsens gefunden werden kann, gehört ebenfalls zur sozialen Kompetenz – und diese lässt sich weder im fremden Raum erlernen noch im eigenen; denn entweder unterwirft man sich fremden Regeln oder stellt seine eigenen auf.
Geteilte Räume ermöglichen individuelle Gestaltungen. Je nach Art des Raumes sind diese entweder sehr lokal begrenzt, zum Beispiel auf den Schreibtisch, oder können sehr raumgreifend wirken, zum Beispiel in einer Wohnung. Oft gewinnt dabei nicht die Lösung, die allen gefällt, sondern jene, die bei niemandem auf Ablehnung stößt. Das gilt sowohl für die Gestaltung des Raumes als auch für das Miteinander im Raum. In diesem Miteinander und Aushandeln dieses Miteinanders erleben wir uns als soziale Wesen: miteinander, füreinander, gegeneinander.
Das Gelassenheitsgebet bildet den Rahmen für unser Leben in geteilten Räumen: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“
Dinge, die ich nicht ändern kann:
- Kollegen, mit denen ich das Büro teile
- Einflüsse des Wetters
- automatische Klimakontrolle (sofern vorhanden)
- Grundschnitt des Raumes, Position von Fenstern und Türen
- Anschlüsse
- Einstellungen und Werte bzw. Prinzipien der Raum-Mitbenutzer
Dinge, die ich ändern kann:
- Menschen, mit denen ich meine Wohnung teile
- Temperatur im Raum (Klima-Anlage, sofern vorhanden, und Heizung)
- Mobilar und Raumaufteilung
- Wandgestaltung
Wie gern verwechsle ich das eine mit dem anderen und:
- jammere über unmögliche Kollegen
- beschwere mich über zu heißes oder zu kaltes Wetter
- lästere über vorhandene Bilder an den Wänden
Als Brennpunkte der Zivilisation bzw. des Erlernens ziviler oder sozialer Regeln ist das Leben in geteilten Räumen essenzieller Bestandteil des Menschwerdens und -seins. Oft finden wir erst in der Abgrenzung zu anderen oder in stiller oder offener Auseinandersetzung mit diesen zu uns selbst.
- Teil 1: Fremde Räume – Kirche, Kaserne, Großraumbüro
- Teil 2: Geteilte Räume – Wohnung, Mehrpersonenbüro, öffentlicher Raum
- Teil 3: Eigene Räume – Elsas Eispalast, Raumschiffe, Arbeitszimmer, Kinderzimmer

 ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||
ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||