
Microsofts Entscheidung, nur ein Betriebssystem für alle Gerätetypen anzubieten, stieß auf eine gehörige Portion Skepsis. Handy, Tablets, Laptops und Desktop-PCs laufen alle mit der selben Windows-Version, nur die Bedienung unterscheidet sich. Mit Windows 8 begann das Betriebssystem-Abenteuer, mit Windows 10 wurde es dem Vernehmen nach zur alltagstauglichen Reife geführt. Da mir endlich ein plausibler Anwendungsfall präsentiert wurde, setze ich mich mit diesem Ansatz einmal – wenn auch theoretisch – auseinander.
Mir geht es dabei vorwiegend um die User Experience als Gesamterlebnis eines Gerätes, das in verschiedenen Nutzungssituationen verwendet wird. Diese User Experience kann allenfalls als Indikator für Kaufbereitschaft gesehen werden, sagt letztlich aber nicht unbedingt etwas über den Erfolg am Markt aus.
Ein System für alle Geräte in der Praxis
Der Anwendungsfall bezieht sich auf eine Person, die an mehreren Orten arbeitet. Welches Gerät hat eine solche Person mit der höchsten Wahrscheinlichkeit immer dabei:
- Telefon,
- Tablet,
- Laptop oder
- Desktop-PC?
Ein Smartphone ist von allen Geräten am stärksten auf Mobilität optimiert (kleine Bauform, akzeptable Akku-Laufzeit, geringe Abhängigkeit von der Umgebung). Diese Person steht vor folgenden Aufgaben:
- eine Datei zu Hause erstellen
- unterwegs (in der Bahn, im Flugzeug, in Wartesituationen) durchsehen
- im Büro bearbeiten und anreichern
- in einer anderen Stadt im Hotel noch einmal überarbeiten
- in fremder Umgebung präsentieren
Zuhause verfügt die Person über Monitor, Tastatur und Maus, ebenso im Büro. Im Hotel steht meist ein Fernseher zur Verfügung, der als Monitor zweckentfremdet werden kann. In der fremden Umgebung wartet ein Beamer oder Fernseher, die Standard-Anschlüsse besitzen.
Warum also nicht einfach das Handy gleich als Computer verwenden? Es zuhause und im Büro an die sowieso vorhandenen Monitor, Tastatur und Maus anschließen, im Hotel an den Fernseher und in der Fremde an die Standardanschlüsse? Ein entsprechendes Adapterest genügt. So kann die Person an allen Orten auf dem „selben Computer“, in der selben virtuellen Arbeitsumgebung, arbeiten und muss sich nicht auf die Cloud oder andere Dateiübertragungswege verlassen.
Je nach angeschlossenen Geräten (Monitor, Tastatur, Maus – oder nichts von alldem) wechselt der Handy-Mobilcomputer die Darstellung zwischen touch-optimierter Bedienung und maus/tastatur-optimierter Bedienung in der klassischen Fensterlogik. Auf dem integrierten Handybildschirm bleibt die mobile Darstellung, aber auf dem angeschlossenen Zusatzbildschirm wird die „klassische“ Desktop-Oberfläche verwendet.
Dieser Anwendungsfall ist für mich so einleuchtend und nachvollziehbar, dass ich mich über meinen einstigen Hohn impulsiv geärgert habe. Und Windows 10 scheint das tatsächlich hinzubekommen und alltagstauglich zu ermöglichen. Dass die Person mir berichtete, aus Sorge und Vorsicht doch den Laptop mitgenommen zu haben, kann als anekdotisches Indiz für eine nicht allzu positiv empfundene User Experience (jedenfalls bezüglich der Zuverlässigkeit/Verlässlichkeit) gelten. Um die User Experience dieser Person etwas neutraler bzw. abstrakter zu beurteilen, lohnt sich ein Blick auf die alternative Gerätewelt.
Getrennte Systeme für unterschiedliche Systeme
Auf der anderen Seite liegt die Mac/iOS-Welt. Da haben Laptops/PCs und Handys/Tablets jeweils eigene Betriebssysteme. Auf der untersten Ebene sind es zwar die gleichen Systeme, aber bereits die verfügbaren APIs (Programmschnittstellen) unterscheiden sich. In der Bedienung liegen scheinbar Welten zwischen beiden Systemen, auch wenn Funktionen von einer Plattform immer wieder auf die andere übertragen werden.
Auf dem Laptop/PC gelten folgende Prinzipien:
- möglichst viel Leistung
- Multitasking durch Fenstervielfalt (begleitet durch Fullscreen-Monotasking-Unterstützung)
- abhängig von Zeigegerät (Maus) und Eingabegerät (Tastatur)
- so viele Bedienelemente wie verfügbar anbieten, abhängig von Menü-Funktionalität
- potenziell sehr unterschiedliche Bildschirme (in Laptops eingebaute, [zusätzlich] angeschlossene)
- viel Freiheit zur Gestaltung des virtuellen Arbeitsplatzes (da groß bis sehr groß)
Für Mobilgeräte (mit iOS) sind andere Prinzipien relevant:
- möglichst viel Akkulaufzeit (ggf. zuungunsten der Leistung)
- primär Monotasking (einige Funktionen für Multitasking-Situationen)
- Anzeige dient gleichzeitig der Eingabe (Touch) bzw. stellt Eingabebereiche zur Verfügung (Touch-Tastatur, die Anzeigebereiche verdeckt – also noch weniger Platz zum Arbeiten)
- große Bedienelemente (Symbole), möglichst wenige davon auf dem Bildschirm (nur die relevantesten), Vermeidung von Menü-Bedienungen
- primär nur die vorhandene Bildschirmfläche (Spiegeln/Übertragen auf externen Bildschirmen via „AirPlay“ möglich)
- wenig Freiraum zur Gestaltung des virtuellen Arbeitsplatzes (aufgrund der Beengtheit ist Pragmatismus das höchste Gebot)
Viele Touch-Gesten stehen auch auf einem Computer zur Verfügung, wenn dieser ein TouchPad für die Eingabe nutzt. Viele Tastaturfunktionen stehen auch auf dem Mobilgerät zur Verfügung, wenn man eine Bluetooth-Tastatur verwendet. Der Hauptunterschied liegt weniger in der Technik darunter als vielmehr in der Präsentation und Bedienung – und diese sind wichtige Elemente der Nutzererfahrung, der User Experience.
Die User Experience berücksichtigt neben der konkreten Usability von Soft- und Hardware das Gesamterlebnis der Nutzung in seinem konkreten Kontext und die dabei entstehende emotionale Befindlichkeit des Anwenders: zufrieden, gleichgültig, frustriert, verärgert, erleichtert, angespannt, etc.
Der einzige Fall, in dem von einem iOS-Gerät realistischerweise MacOS-Fähigkeiten (Fenster, Zeigerbedienung, Menüs etc.) erwartet werden, ist jener, in dem ein größerer Bildschirm angeschlossen wird. Auch wenn es theoretisch möglich wäre, mittels AirPlay beispielsweise einen Fernseher als Bildschirm zu nutzen und Eingaben mit einer externen Tastatur vorzunehmen, so ist für diese Nutzungssituation nicht beabsichtigt, einen Wechsel des Bedienparadigmas bereitzustellen. Dass sich ein iOS-Gerät zum Computer degradiert, der auf externe Ein- und Ausgabegeräte angewiesen (!) ist, wird von dem Gerät weder erwartet noch wurde es in dieser Hinsicht konzipiert – es ist und bleibt selbst das primäre Interaktionsgerät für den Nutzer.
Vielleicht ist „one fits all“ doch besser?
Wie Windows 10 demonstriert (und iOS mit der Tastatur-Unterstützung ebenfalls) ist ein flexibler Ad-hoc-Wechsel der Eingabe-Bedienung je nach verfügbaren Möglichkeiten durchaus sinnvoll. Bleibt die Präsentation gegenüber dem Nutzer. Auf dem Mobilgerät folgt diese ganz anderen Paradigmen als auf einem Computer. Und da habe ich letztlich doch einige Bedenken.
Wer sich mit responsive Design in Webseiten eingehender beschäftigt, stellt bald die fantastischen Möglichkeiten und die frustrierenden Begrenzungen des „One fits all“-Ansatzes fest:
- Die Reihenfolge der Elemente wird global definiert (HTML-Code).
- Das Aussehen wird je nach Bildschirmgröße angepasst (CSS-Anweisungen).
- Es ist nicht ratsam, zu viele Elemente mitzuschleifen, die in verschiedenen Ansichten ein- bzw. ausgeblendet werden (Stichwort: Ladezeit, Datenmenge).
Schnell gerät man in die Gefilde einer Komplexität, wo das Umsetzen bestimmter Ideen zwar technisch möglich, aber wirtschaftlich unsinnig ist. Der Umsetzungsaufwand und die Nebeneffekte (Testen in allen Soft- und Hardwareumgebungen, Google-Einschätzung, Ladezeit, Wartbarkeit des Codes etc.) sind einfach zu hoch.
Vor einem strukturell ähnlichen Dilemma steht jede Software für eine „One fits all“-Softwareumgebung:
- Geeignete Bedienoberfläche (Menüs, Symbolleiste/Ribbons, Bedienelemente, etc.) …
- … für jede Nutzungssituation (Handy-Bildschirm, Tablet-Bildschirm, PC-Bildschirm, vorhandene Eingabegeräte) bereitstellen.
Das selbe Programm, beispielsweise Word, gibt sich also einmal funktionsmächtig auf dem Computer und einmal funktionsreduziert auf dem Mobilgerät. Die selbe Datei kann ich also einmal mit allen möglichen Funktionen bearbeiten und einmal nur mit ausgewählten Funktionen – auf dem selben Gerät.
Die iPad-Version von Word wirkt schlank und effizient. In dieser Gestalt gefallen mir sogar die Ribbons, da sie optisch zurückhaltend und gut bedienbar sind (sie wirken eher wie eine Symbolleiste als die Ribbons in der Computerversion). Jedoch fehlen zahlreiche Befehle, die mir in der Mac-Version zur Verfügung stehen. Alle wichtigen sind zwar scheinbar da, aber beispielsweise kann ich weder ein Inhaltsverzeichnis einfügen noch Formatvorlagen verwalten.
Übrigens ist es dann besonders peinlich, wenn Word einfach abstürzt. Es hat schon weniger Funktionen als die Computerversion, aber beim Aufruf der Datei-Eigenschaften verabschiedet es sich bei mir, und dabei gehen meine letzten Textänderungen verloren. Wenn also von den wenigen Dutzend Funktionen eine nicht funktioniert, ist mein Vertrauen in die App deutlich gemindert, die User Experience kann als katastrophal gelten. Ohne diesen zufällig entdeckten Absturzpunkt hätte ich die Schulnote „2“ vergeben (als eigenständige App wäre es eine „1“ gewesen, aber es muss nun mal den Vergleich zur PC-Version antreten). So schnell können Meinungen kippen: von „2“ zu durchgefallen.
Bei der User Experience geht es nicht primär um die harten Fakten (es ist ja nur eine marginale, sehr seltene Funktion), sondern um die Wirkung auf den Nutzer (ich habe Misstrauen, beargwöhne Unzuverlässigkeit, unterstelle Schlampigkeit).
In der Pareto-Falle
Vilfredo Pareto (1848–1923) definierte die nach ihm benannte Pareto-Verteilung, die erstaunlich oft zutrifft: In der häufig gehörten Abwandlung werden 80 Prozent des Ergebnisses mit 20 Prozent des Aufwandes erreicht. Für die übrigen 20 Prozent des Ergebnisses werden die übrigen 80 Prozent an Aufwand benötigt. Oder noch direkter: Wenn ich eine perfekte App erstellen will, benötige ich vielleicht tausend Arbeitsstunden. Binnen 200 Stunden habe ich bereits eine Version, die 80 Prozent der Anforderungen erfüllt. Ich müsste jetzt also weitere 800 Stunden aufwenden, um die verbleibenden 20 Prozent der Anforderungen auch noch zu erfüllen. Meist sind in diesen 20 Prozent die wirklich bösen Fälle versteckt, die einfach keinen Spaß machen oder die bisherige Arbeit bzw. den verfolgten Ansatz komplett infrage stellen.
Ähnlich sehe ich es mit dem „one for all“-Ansatz: 80 Prozent meiner Anforderungen können solche Geräte gut erfüllen. Die übrigen 20 Prozent umfassen:
- Bedienkomfort
- Verständlichkeit
- Konsistenz
- ungewöhnliche Anwendungsfälle
In der Computerwelt sind diese Probleme zu lösen. In der mobilen Welt ebenso. Doch eine Lösung so zu entwickeln, dass sie die gleichen Probleme gleichermaßen in beiden Welten löst, stellt ganz neue Herausforderungen.
Für die Nutzer kommen mehrere Aspekte hinzu:
- Das selbe Gerät muss Speicherplatz für zusätzliche Elemente (Darstellung im jeweils anderen Modus) bereitstellen.
- Um auch in der Computer-Nutzungssituation halbwegs befriedigen zu können, ist mehr Rechenleistung nötig als für die reine Handy-Nutzung.
- Dabei ist noch nicht einmal klar, ob dieser andere Modus benötigt wird, d.h. für einige Kunden wird völlig unnötig Speicherplatz belegt und Rechenleistung benötigt.
- Das selbe Gerät wird letztlich auf zwei sehr unterschiedliche Weisen bedient, was die mentale Komplexität erhöht: Es genügt nicht mehr, dass ein Gerät etwas grundsätzlich kann, sondern es kann das eben nur in einer bestimmten Nutzungssituation.
In der Mobilverwendung wirkt sich v.a. der begrenzte Bildschirm spürbar aus und beschränkt die Nutzungsmöglichkeit. Für die Einschätzung, ob eine solche mobile Lösung funktioniert, sind mehrere Faktoren entscheidend:
- Vorhandensein geeigneter Workarounds
- Bereitwilligkeit zur Akzeptanz von Fehlstellen
- Gesamtwirkung der Lösung (z.B. Performanz, Gesamteindruck bzgl. Qualität/Durchdachtheit)
Letztlich läuft es auf die Erwartungen des Nutzers hinaus: An ein Mobilgerät werden andere Erwartungen gestellt als an einen Computer. Und hier liegt die Krux: Unter Windows 10 ist diese Grenze aufgehoben, d.h. jede funktionale Beschränkung im Mobilmodus ist aus Sicht des Nutzers letztlich willkürlich – egal wie gut begründet und durchdacht sie sein mag.
Die User Experience für den Mobileinsatz mag hoch sein, die für den Computer-Einsatz ebenfalls, doch wirkt sich die Erfahrung der Möglichkeiten in Computer-Situationen auf die Erwartung und Beurteilung der Mobilsituation aus. Wer häufig zwischen beiden wechselt, wird bei jedem Wechsel auf die Veränderungen aufmerksam, bis die zunehmend erkennbaren Beschränkungen in dem einen Modus das ursprünglich positive Erleben überlagern und als regelmäßiges Kompromiss-Eingehen erlebt werden. Nur weil der Nutzer die Beschränkungen rational plausibilisieren kann, heißt das noch nicht, dass sie ihm gefallen. Emotionale Beurteilung und rationales Verständnis müssen nicht synchron sein.
Mit dem „one fits all“-Ansatz tritt das Handy in Konkurrenz zum Computer. Natürlich wäre es vermessen zu erwarten, dass beispielsweise Adobe Photoshop genauso effektiv und flott funktioniert wie auf dem Büro-PC. Wieso eigentlich? Es läuft doch. Es sieht sogar genauso aus (wenn ich einen Monitor anschließe). Aber wieso macht das Arbeiten damit auf dem Mobilgerät keinen Spaß? Vielleicht liegt das an der geringeren technischen Leistung.
Für Gelegenheitsnutzer ist sowas noch akzeptabel. Aber das eingangs geschilderte Anwendungsszenario stammt aus der Power-User-Welt, und diese geben sich mit solchen Grenzen nicht zufrieden. Am liebsten würden sie ihr Handy aufrüsten (mehr Power!), um damit genauso effizient zu arbeiten wie mit ihrem Computer.
Fazit: Skepsis bleibt
Aus drei Gründen bleibt meine Skepsis bezüglich des „one fits all“-Ansatzes von Windows 10 bestehen:
- Die unterschiedlichen Nutzungssituationen erfordern unterschiedliche Bedienparadigmen => das selbe Gerät will je nach angeschlossenen Geräten anders bedient werden => erhöhte mentale Komplexität.
- Die unterschiedlichen Gerätetypen folgen unterschiedlichen Prämissen und stellen dadurch mehr oder minder geeignete Ressourcen zur Verfügung => Notwendigkeit von vielen Ressourcen, ob der Nutzer sie tatsächlich benötigt, ist dabei unerheblich => technologischer Ballast und Kompromisse (z.B. bzgl. Akkulaufzeit, Ausstattung/Preis, dennoch begrenzte Leistungs- und Einsatzfähigkeit in der Computernutzungssituation).
- Höherer Entwicklungsaufwand einer integrierten Lösung für alle (wenn sie gut sein soll) im Vergleich zur getrennten Entwicklung von jeweils optimal auf die jeweilige Nutzungssituation abgestimmter Lösungen => höherer Aufwand für Entwickler, die nicht sicher sein können, dass sich die Investition amortisiert => aus Kostendruck keine harmonische Software/App-Landschaft, sondern manche sind nur mobil sinnvoll nutzbar, andere nur im Computermodus – aber alle belegen Speicherplatz, der womöglich dann für anderes fehlt.
Auch wenn die Entwickler sich an die Prinzipien von Microsoft halten mögen, ist der Aufwand nicht zu unterschätzen. Mit Entwicklung ist nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch die konzeptionelle Arbeit gemeint. Dazu kommt, dass die Ribbon-Bedienung im Touch-Umfeld zwar geeignet ist, für Power-User jedoch zahlreiche Einschränkungen im Nutzungsalltag bringt – einige Vorteile wurden mit neuen Nachteilen erkauft.
Entscheidend ist letztlich die Erwartung der Nutzer. Das Erwartungsmanagement von „one fits all“ weckt beim Nutzer Begehrlichkeiten und führt die Unzulänglichkeiten bestimmter Situationen vor Augen. Diese treten vor allem beim Wechsel der Nutzungssituationen zutage. Wer ein Handy nur als Handy benutzt und diese Nutzungssituation nicht verlässt, wird die geschilderten Beschränkungen beim Moduswechsel nicht als Mangel wahrnehmen.
Apple betreibt mit seiner klaren Trennung zwischen MacOS und iOS solides Erwartungsmanagement, und die Lösungen sind auf ihre jeweilige Nutzungssituation optimiert: beispielsweise lange Akkulaufzeit auf Mobilgeräten und Leistung auf Computern.
Mit seinen eigenen Tools (Pages, Numbers, Keynote) fährt das Unternehmen die gleiche Strategie wie mit den Systemen: Computer- und Mobilversion basieren auf der selben Technologie, jedoch ist die Oberfläche auf die jeweilige Umgebung optimiert, ohne Brüche oder Fragen zu erzeugen. Auch eine Web-Version dieser Programme gibt es, deren Bedienung an die Mobilgeräte angelehnt ist. So ergibt sich eine konsistente User Experience, die auf die jeweiligen Situationen optimiert ist.
Ich glaube, Windows 10 hat einen sehr interessanten Weg eingeschlagen. Langfristig könnte sich dieser auch auszahlen. Derzeit bestehen die Defizite m.E. vorwiegend in den technischen Beschränkungen von Mobilgeräten und einem suboptimalen Erwartungsmanagement. Nur weil ein Gerät etwas (theoretisch) kann, heißt das nicht unbedingt, dass man es auch (praktisch) gern nutzt. Aber wozu habe ich dann all die Fähigkeiten in meiner Hosentasche, wenn ich sie kaum benutzen möchte – eben weil mir bei jeder Nutzung die Beschränkungen bewusst werden?
Sicher, das sind keine wirklichen wirtschaftlichen oder harten Bedenken, sondern eher unterschwellige Gedanken, die sich auf das Nutzererlebnis auswirken, dessen Einschätzung durch die Erwartung geleitet wird.
Epilog: Prognose
Und weil es von Artikeln solcher Art erwartet wird, hier noch eine Prognose.
Derzeit sehe ich geringe Chancen für Microsoft auf dem Mobilmarkt. Langfristig wird sich das ändern, und sie werden die Multi-Geräte-Plattform für Entwickler und Nutzer besser integrieren. In den kommenden Jahren werden sich die Mobiltechnologie weiterentwickeln und die Nutzererwartungen an den tatsächlich erhaltenen Fähigkeiten ausrichten. Dadurch steigt die Zufriedenheit, weil die Geräte halten, was von ihnen erwartet wird (basierend aus Erfahrungen/Berichten aus dem Alltag und nicht auf Marketing).
Das Surface demonstriert als Zwitter sehr schön, dass der Ansatz insgesamt funktionieren kann und eine gute User Experience besitzt. Jedoch ist es als Tablet nicht so repräsentativ, um die beschriebene Kluft zwischen Handy und Desktop-PC argumentativ zu überbrücken.
Dass Microsoft derzeit mit seiner Gängelung, endlich Windows 10 zu installieren, die User Experience eher negativ beeinflusst, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls startet ein aufgezwungenes System von einer negativen emotionalen Basis.
Aktuell hat Apple mit seiner strikten – und leicht kommunizierbaren und verständlichen – Trennung zwischen Mobilgeräten und Computern das geeignetere Angebot, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Es liefert weniger Frusterlebnisse, da die Möglichkeiten jeweils im Bereich der Nutzererwartungen angeboten werden. Durch die gemeinsame Systembasis hält sich Apple den Weg offen, Mobil- und Computer-Welten in einer geeigneten Zukunft zu verschmelzen.
In der Verkürzung zum Thema Erwartungsmanagement:
- Apple: Mobil und Computer sind unterschiedlich.
- Microsoft: Mobil und Computer sind gleich, aber letztlich doch unterschiedlich.
Für die Zukunft ergeben sich daraus zwei Wege:
- Apple: Mobil und Computer verschmelzen.
- Microsoft: Wir haben es doch schon immer gesagt: Mobil und Computer sind gleich, aber letztlich doch unterschiedlich.

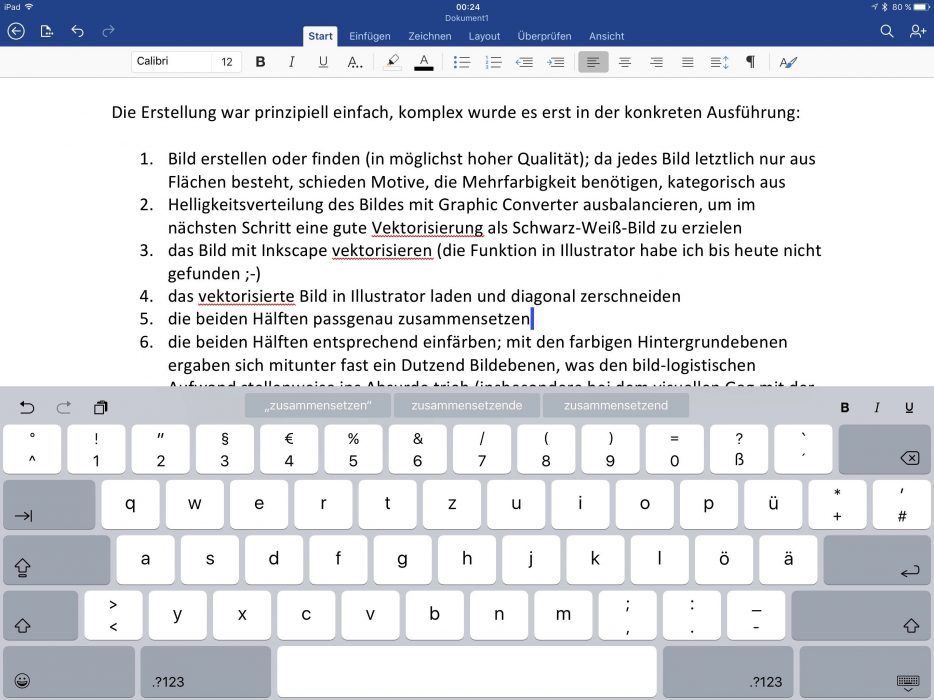
 ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||
ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||