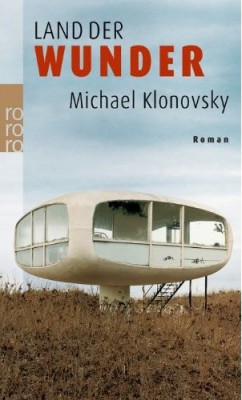
Ein begnadeter Stilist, sei Klonovsky, bescheinigt Jürgen von der Lippe dem Autoren. Das steht auf dem Klappentext und auch sonst überall. Nunja, einige Sätze sind wirklich fein gedrechselt, einige Wortbildungen und Formulieren entbehren tatsächlich nicht einer gewissen Finesse und lassen den Willen zum interessanten Umgang mit der deutschen Sprache erkennen. Auf der Negativ-Seite ist zu vermerken, dass ich immer noch nicht weiß, was dieses Buch ist.
Man könnte dahergehen und sagen, es sei ein Roman. Aber das lässt sich noch präzisieren, oder? Ist es eine Satire? Eine fiktionale Dokumentation? Eine Art Bildungs- oder Entwicklungsroman? Vielleicht hilft die inhaltliche Übersicht beim Verständnis.
Der erste Teil (das entspricht nicht unbedingt den Teilen, in die das Buch gegliedert ist), kann als satirische oder humorvolle Schilderung gelten. Die Hauptfigur Johannes Schönbach arbeitet im Lager für Spirituosen und soll eigentlich die Republik mit Schnaps versorgen. Tatsächlich versorgt sich Schönbach wie auch seine Kollegen lieber selbst. Dabei sind zahlreiche Reflexionen über das Land namens DDR, die Menschen darin und Schönbachs Biografie und geistige Verfassung eingewoben. Schließlich gelingt es Schönbach – unter literarischer Überspringung von anderthalb Jahren –, als Korrektor bei einer Tageszeitung zu arbeiten. Der erste Teil ist vergnüglich und heiter und vergleichsweise flott.
Im zweiten Teil erlebt Schönbach die Umsturztage mit. Gerade die Focalisierung auf ihn gibt den Geschehnissen einerseits eine dokumentarische Unbefangenheit, andererseits aber auch ein gutes Gefühl für jene Wochen. Das ganze kulminiert in seiner Verhaftung, als er durch Zufall in eine Demonstration gerät. In gefühlter Echtzeit werden seine Erlebnisse in jener Nacht geschildert. Das ist bedrückend und im krassen Widerspruch zum ersten Teil.
Der dritte Teil begleitet Schönbachs journalistische Karriere. Er wird Redakteur bzw. Reporter bei der Berliner Tageszeitung, arrangiert sich mit dem neuen West-Chef, schwimmt im Geld und landet irgendwann bei einem Boulevard-Magazin in München. Am meisten enttäuscht, dass der Roman nach seinem starken ersten Teil im dritten Teil vergleichsweise unwitzig ist. Allenfalls auf einer intellektuellen oder Meta-Ebene ist er tatsächlich witzig, wenn das Münchner V.I.P.-Magazin (und seine Redakteure) thematisiert werden. Direkte Komik gibt es kaum noch, allenfalls bedauert man Schönbach, der viel zu passiv bleibt und wenn er aktiv wird, seltsame Entscheidungen trifft (sich z.B. mit den falschen Frauen einlässt oder selbst nicht weiß, was er tatsächlich will). Als interessante Haupt- und Bezugsfigur taugt er in seinem Münchner Hedonismus leider kaum noch (das ist alles spätestens mit dem Film „Rossini“ mehr als genug durchgekaut worden). Seine ersten Berührungen mit Wessis und Westberlin chargieren irgendwo zwischen gut eingefangener Stimmung und „Was für ein naiver Döskopp!“ Das hat zwar immer wieder dokumentarischen Wert, ist aber weder so spöttisch-flott wie im ersten Teil noch so bedrückend wie im zweiten.
Im vierten (und kürzesten) Teil gelangt Schönbach durch Aktiengeschäfte zu Reichtum, hilft einer ehemaligen Angebeteten mit einer Anschubfinanzierung, macht aus dem Esoterik-Geschäft der Eltern eine florierende Ladenkette und wird schließlich geläutert. Vier Probleme hat der vierte Teil. Der Biss gegenüber der Dot-Com-Blase bzw. den Aktienschnöseln fehlt (da war man ja im ersten Teil regelrecht verwöhnt worden und erwartet nun gleiches). Das wirkt eher wie ein fades Deus-ex-Machina-Element. Das Esoterik-Geschäft (energetisches Wasser) der Eltern ist zu knapp, um zu interessieren, zu gaga, um zu schmunzeln, zu real, um zu spotten. Die ehemalige Angebetete ist zwar als Obsession (bereits im ersten Teil) eine nette Idee, taucht aber zu oft nur auf, wenn sie gebraucht wird, sie zieht sich nicht als wirkliche Obsession durch den Text. Die Läuterung ist arg sentimental, passt nicht zum Rest des Buches und irgendwie passt sie nicht zu Schönbach. Letztlich hat der vierte Teil gefühlt hundert Seiten zu wenig oder zwei Themen zu viel – und entschieden zu wenig Distanz zu seinen Themen, um spöttisch und unterhaltsam zu sein.
Fazit: Nach einem starken Anfang gehts bergab. Aber insgesamt eine Lektüre, die man nicht bereut. Nur für das Ende gilt das gleiche wie für die meisten Hollywood-Filme: Viel zu sentimental, und man sollte einfach fünf Minuten vor Schluss ausschalten.

 ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||
ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||
Pingback: Kürzlich gelesen: Eine kurze Geschichte von fast allem (2003) | zanjero.de